Ahimsa, „Gewaltlosigkeit“ – wer denkt da nicht sofort an Mahatma Gandhi, Weltfrieden und vegane Ernährung? Im Yoga steht Ahimsa an erster Stelle unter den ethischen Leitlinien, den Yamas und Niyamas, und soll nicht nur unsere spirituelle Praxis, sondern auch unser Leben jenseits der Matte prägen. Doch bei all den großen Idealen übersehen wir leicht, wie oft wir uns selbst Leid zufügen – besonders dann, wenn der eigene Körper nicht mehr mitmacht. In diesem Beitrag teile ich mit dir, was ich als Yogalehrerin von meiner Frozen Shoulder über Ahimsa gelernt habe – und wie gewaltfreies Yoga bei Frozen Shoulder aussehen kann.
Gewaltlosigkeit beginnt im Inneren: Eine Frozen Shoulder als Weckruf
Wenn wir uns in der Welt umschauen, mag es banal erscheinen, bei diesem großen Ideal von Ahimsa (Gewaltlosigkeit) über etwas Alltägliches wie eine Frozen Shoulder zu schreiben. Aber dieses Beispiel hat mir selbst wieder einmal vor Augen geführt: Schon in diesen vergleichsweise kleinen Dingen müssen wir einen gewaltlosen Umgang mit uns selbst oft erst lernen. Wie wollen wir die großen Probleme der Welt erfolgreich anpacken, wenn wir uns unbeabsichtigt immer wieder selbst Schaden zufügen?
Die Autorin, Dozentin und Yogalehrerin Deborah Adele hat dafür einen sehr anschaulichen Vergleich:
„Wir würden niemals eine Dose roter Farbe kaufen und erwarten, dass sie blau wird, wenn wir sie auf unsere Wände auftragen. Und doch können wir hart und fordernd mit uns selbst umgehen und gleichzeitig von uns erwarten, dass wir andere Menschen liebevoll behandeln. So funktioniert das aber nicht. Die Farbe in der Dose ist die Farbe, zu der alles wird, was wir damit anstreichen. Die „Farbe“ unseres Umgangs mit uns selbst ist die „Farbe“ der Art, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Wenn wir nicht sicher in uns selbst ruhen, können auch andere Menschen sich in unserer Gesellschaft niemals sicher fühlen, und die Welt kann kein sicherer Ort sein. Wir behandeln andere Menschen genauso wie uns selbst.“
Deborah Adele in „Yama und Niyama: Die 10 ethischen Grundregeln des Yoga“
Wie im Innen, so im Außen. Es beginnt also immer mit uns. Unser Alltag, unser echtes Leben ist der Spielplatz, auf dem wir unsere Ideale erforschen und erproben können. Und dabei hat jede einzelne Erfahrung das Potenzial, unseren Blickwinkel zu verändern und mehr Bewusstsein und Mitgefühl (für uns selbst und für andere) zu schaffen. So ging es mir in den letzten Monaten mit der Frozen Shoulder.
Akupunktur, Ayurveda, aber vor allem: Abwarten
Mit meiner Frozen Shoulder habe ich jede Menge versucht. Manuelle Therapie, Mobilisierung, Krankengymnastik am Gerät – das volle Programm, das die Physiotherapie hergibt. Ich habe Hormone und Ayurveda-Öle probiert, Akupunktur, Schmerzsalben, Weihrauch innerlich und äußerlich.
Bis mir kürzlich ein Schulterspezialist sagte: „Leider kann ich Ihnen nichts Gutes tun. Das ist ein typischer Verlauf bei diesem Krankheitsbild, der einfach Geduld erfordert. Es wird jetzt von allein sukzessive besser werden, aber stellen Sie sich darauf ein, dass Sie wahrscheinlich noch Geduld brauchen werden.“
Darauf war ich schon vorbereitet – es war mir frustrierend bewusst, dass der Heilungsprozess üblicherweise etwa ein Jahr dauert. Nach knapp 6 Monaten sage ich mir mittlerweile: Die Hälfte ist bestimmt schon geschafft.
Ahimsa statt Aktivismus
Ich war ein bisschen stolz auf mich, denn monatelang hatte mir in meinen Yogakursen niemand angemerkt, dass ich den einen Arm kaum heben konnte. Dass jeder herabschauende Hund unsauber demonstriert und schmerzhaft war. Ich wollte die Situation mit ehrgeizigen Therapieplänen und diversen innerlichen und äußerlichen Mitteln möglichst schnell in den Griff bekommen. Schnell zurück zum „Normalzustand“ – und bis dahin Zähne zusammenbeißen und professionell weiter unterrichten.
Natürlich habe ich mir die Frage gestellt: Was will mir mein Körper mit dieser Frozen Shoulder sagen? Dass es eine Lektion in Geduld sein würde – das war offensichtlich.
Aber der Orthopäde gab mir, vermutlich ohne es zu ahnen, noch eine andere Antwort auf diese Frage. Denn er sagte: „Was in vielen anderen Situationen empfehlenswert ist, funktioniert hier leider nicht. Die Patienten, die sich bemühen, die viel tun und trainieren, die haben den langsamsten Heilungsverlauf. Die „faulen“ Patienten, die einfach nichts tun – bei denen heilt die Frozen Shoulder am schnellsten aus.“
Es ist also mehr als nur eine Frage der Geduld. Es ist auch eine Lektion in Ahimsa. Denn „kein Leid zufügen“ – das betrifft auch uns selbst.
Warum eigentlich Gewaltlosigkeit im Yoga?
Die fünf Yamas oder ethischen Gebote der Selbstbeschränkung (Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparigraha) sind unser Fundament, wenn wir Yoga nicht nur als Freizeitbeschäftigung, sondern als Lebensweg betrachten wollen. Pandit Rajmani Tigunait, der spirituelle Leiter des Himalayan Insititute, erläutert:
„Sie bringen den edlen und respektablen Menschen in uns zum Vorschein. Wir werden zu Vorbildern und sind für niemanden mehr eine Quelle der Angst. Diese Selbstbeschränkungen erleichtern unser Leben und lassen uns viel Zeit und Energie, um uns unserer Hauptaufgabe zu widmen – yoga sadhana.
Pandit Rajmani Tigunait in „Die Praxis des Yoga Sutra – Sadhana Pada“, Kommentar zu Yoga Sutra 2:30
Die Yamas, allen voran Ahimsa (Gewaltlosigkeit), sollen uns also ermöglichen, unsere Yogapraxis (Sadhana) zu vertiefen!
Wie passt das zusammen, wenn man eine Frozen Shoulder nicht einfach „wegtrainieren“ kann? Wenn viele Yogahaltungen (die vielleicht bislang selbstverständlich waren) für den Körper plötzlich nicht mehr zugänglich sind?
Kein Druck, kein Dogma, kein Down Dog: Reflexionsfragen
Gewaltlosigkeit bedeutet für mich in diesem Kontext also ganz konkret: meinem Körper mehr Ruhe zu gönnen, damit er heilen kann – statt ihn durchzuoptimieren (eine hartnäckige Gewohnheit, die sich trotz zunehmender Achtsamkeit immer wieder mal bemerkbar macht).
Vielleicht sind diese Reflexionsfragen auch für dich hilfreich:
- Wo pushst du dich (auf der Matte und im Alltag) an deine Grenzen und darüber hinaus?
- Wo bist du es gewohnt, dich trotz Erschöpfung oder Verletzung weiter anzutreiben, statt dich auszuruhen?
- Welches Verständnis von Yoga steht dir im Hinblick auf eine Verletzung oder Erkrankung im Weg?
- Welchen Wert gibst du deiner Praxis, wenn du keine „Höchstleistungen“ erbringen kannst?
- Welche Art von Disziplin verwechselst du vielleicht mit Fürsorge?
- Wie sprichst du innerlich mit dir, wenn du „nur“ ruhst?
- Was fühlt sich gerade wirklich nährend an – und nicht nur „richtig“?
Zum Glück ist Yoga ohnehin viel mehr als nur Asana oder Körperübungen auf der Matte; und der Schwerpunkt meiner eigenen Praxis hat sich schon vor einigen Jahren in Richtung Meditation verschoben.
Wie kann gewaltfreies Yoga bei Frozen Shoulder aussehen?
Achtsamkeit und Selbstreflexion sind die Grundlage dafür, eine Yogapraxis zu schaffen, die uns keinen Schaden zufügt. Darüber hinaus haben sich in meiner Erfahrung der letzten Monate diese Strategien als sehr hilfreich erwiesen, um Yoga für eine Frozen Shoulder anzupassen:
- Sanfte Mobilisierung – nur soweit sie nicht unangenehm oder schmerzhaft ist. Gelenke behutsam zu mobilisieren, hilft, ein angenehmes Gefühl von Durchlässigkeit zu schaffen. Aber: Respektiere die Grenzen des aktuellen Bewegungsspielraums, damit die Entzündung nicht immer wieder aufflammt. Genau das war auch ein Rat, den mein Orthopäde mir gab.
- Egal, was andere auf der Matte machen: Gib dir die Erlaubnis, zu experimentieren und Yoga-Asana abzuwandeln. Konzentriere dich mehr auf die Funktion als auf die äußere Form. Der Sinn einer Seitbeuge ist zum Beispiel, mehr Länge und Freiraum in die Körperseiten zu bringen. Wie kannst du dieses Gefühl in deinem Körper schaffen, ohne dich mit gehobenem Arm in die Haltung hineinzuziehen und das Schultergelenk weiter zu reizen?
- Entspannungsübungen wie Yoga Nidra. Dieser „yogische Schlaf“ führt den Körper häufig in einen tiefen Erholungszustand und wirkt dabei regulierend auf das Nervensystem – insbesondere auf den Parasympathikus, der mit Regeneration und langfristigen Reparaturprozessen in Verbindung steht. Darauf werde ich mich auch in meiner eigenen Praxis in den nächsten Monaten noch stärker konzentrieren. Hier kannst du Karins Erfahrungsbericht über die Wirkung von Yoga Nidra lesen.
Ahimsa bedeutet auch: Praktiziere so, dass du dir selbst damit kein Leid und keinen Schaden zufügst.
Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, wann der nächste Entspannungskurs beginnt, melde dich gern hier für meinen Newsletter an. Darin erfährst du als Erste(r) von neuen Kursterminen.
Was ich als Yogalehrerin daraus gelernt habe
Auch mein Bezug zu Yoga – als Lehrende wie als Praktizierende – hat sich durch diese Erfahrung verändert. Gerade der Umstand, dass ich mit meinen üblichen Strategien (trainieren, üben, optimieren) bei der Frozen Shoulder nicht weitergekommen bin, macht aus einer lästigen Einschränkung gleichzeitig eine wertvolle Lernerfahrung.
Deborah Adele schreibt in ihrem Buch:
„Situationen, in denen wir uns machtlos fühlen, können auch eine Chance sein, neue Fähigkeiten im Umgang mit dem Leben zu erwerben.“
Deborah Adele in „Yama und Niyama: Die 10 ethischen Grundregeln des Yoga“
Oder für mich eine Chance, als Yogalehrerin weiter zu wachsen. Ganz konkret kann ich beobachten:
- Ich beschäftige mich noch mehr damit, wie die einzelnen Bestandteile einer Yogapraxis wirken, und hinterfrage, wodurch diese Effekte zustande kommen.
- Mein Sequencing ist kreativer und nuancierter geworden. Ich experimentiere, wie ich die gewünschte Wirkung erreichen kann, wenn Standard-Asanas keine Option sind. Dadurch kann ich mir selbst und meinen Kursteilnehmern mehr Alternativen und Modifikationen anbieten.
- Fit, beweglich, einschränkungs- und verletzungsfrei zu sein, ist für (vor allem sehr junge) Yogalehrerinnen oft eine Selbstverständlichkeit. Das war es auch für mich lange. Für viele Kursteilnehmer ist es aber ein unbekannter Luxus. Das Gefühl und den Frust zu kennen, wenn der eigene Körper nicht so mitspielt, wie man gerne möchte, hilft, echtes Mitgefühl zu kultivieren – und nicht nur die Idee von Mitgefühl.
Mehr Mitgefühl (für mich selbst und für meine Teilnehmer) bedeutet auch: mehr Ahimsa, weniger Leid. Wenn die Praxis sich ändert, ändert sich auch der Blick – zu Beginn vielleicht nicht immer freiwillig, aber langfristig hoffentlich zum Besseren.
Zum Weiterlesen: Die Yamas und Niyamas
Dieser Blogbeitrag ist Teil einer wachsenden Themenreihe über die Yamas und Niyamas – die 10 ethischen Grundsätze des Yoga, wie sie im Yoga Sutra aufgezählt werden. Hier findest du alle Texte aus dieser Serie:
- Was sind Yamas und Niyamas? Die ethischen Grundlagen des Yoga alltagstauglich erklärt
- Yoga bei Frozen Shoulder: Ahimsa in der Praxis
- Satya: Wahrhaftigkeit durch Schattenarbeit
- Satya: Was ist „echte“ Kommunikation im KI-Zeitalter?
- Asteya: Hör auf, einem Leben hinterher zu jagen, das nicht deins ist
- Asteya: Gegen den Zeitdiebstahl der modernen Welt
- Brahmacharya: Kein Lunch-Date mit Voldemort
- Santosha: Gut genug statt Leistungsdruck
- Santosha: Zufriedenheit hat ein Image-Problem
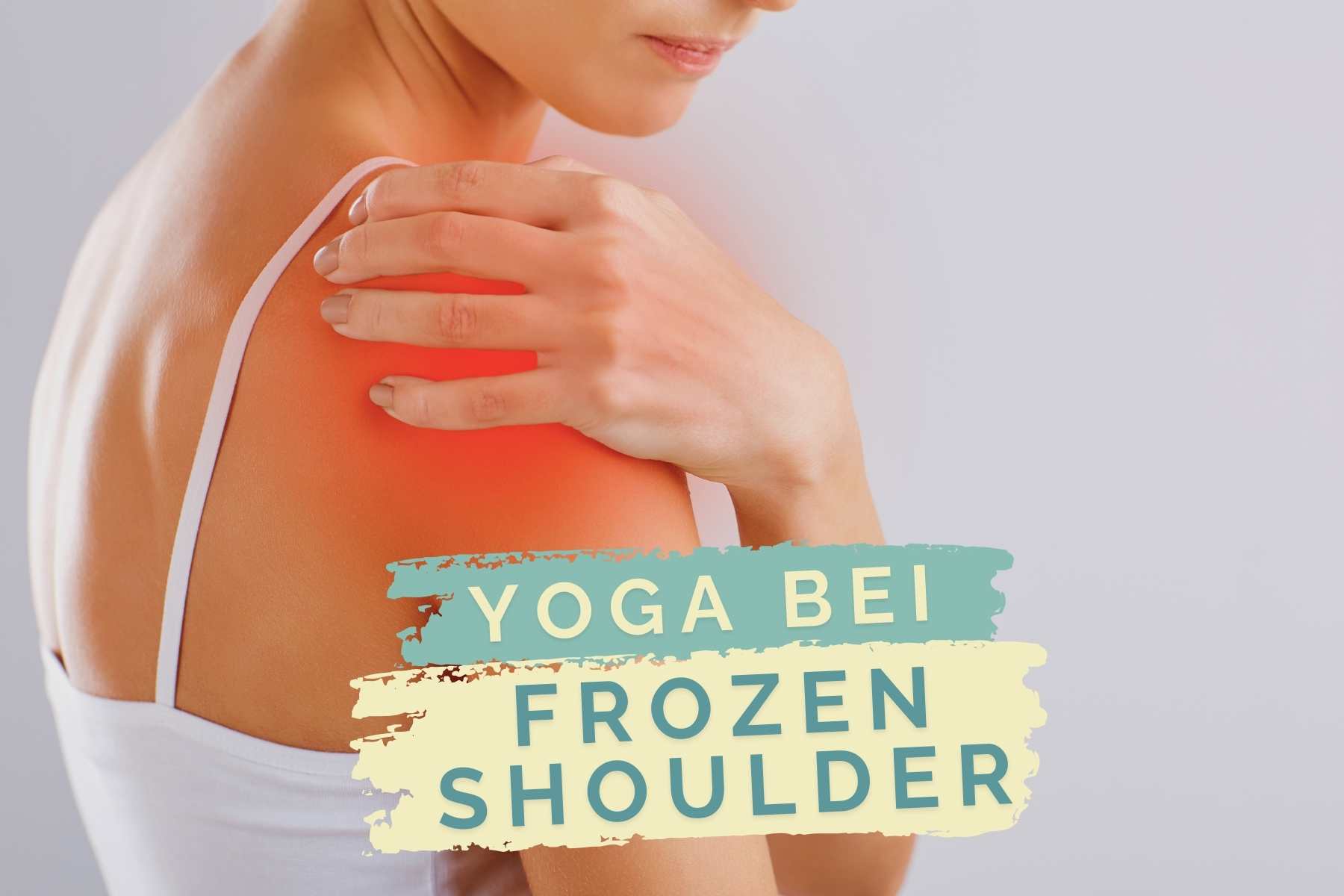

Schreibe einen Kommentar